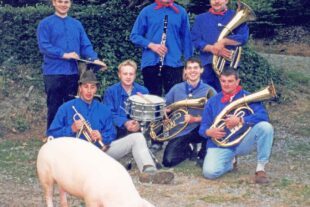Geschichtlicher Beitrag von Dr. Dieter Petri anlässlich des Ortsjubiläums, das in diesem Jahr gefeiert werden kann. Teil 5: Der Nikolaus-Kapellen-Fond.
Das 950-jährige Ortsjubiläum von Unterentersbach, das in diesem Jahr gefeiert werden kann, gibt Anlass, die Geschichte des Ortes in den Blick zu nehmen und auf die eine oder andere Besonderheit aufmerksam zu machen.
Teil 5: Der Nikolaus-Kapellen-Fond
Im Stadtbuch des Reichsschultheißen Meyershofen von 1682 erwähnt dieser eine Stiftung aus dem Jahr 1416. Danach soll jeden Donnerstag in der Nikolaus-Kapelle von Unterentersbach eine hl. Messe gelesen werden.
Bei der Renovation der Kapelle 1981 entdeckte man in der Altarplatte eine Reliquienkapsel. Sie trug das Amtssiegel von Gabriel Haug mit der Jahresangabe 1646. In diesem Jahr war Haug in Straßburg zum Weihbischof eingesetzt worden. Die Zeller Raumschaft gehörte damals zum Bistum Straßburg. Der heutige Bau der Nikolauskapelle stammt aus dem Jahr 1768.
Für die bauliche Erhaltung der Kapelle wurde eine eigene Stiftung eingerichtet. Am 21. November 1820 regelte im Großherzogtum Baden eine Verordnung, wie eine derartige Stiftung zu verwalten sei. Die Entscheidung über die Verwendung des Geldes wurde nicht mehr allein dem Pfarrer überlassen. Von der Kirchengemeinde mussten vier weitere Mitglieder gewählt werden, die mit dem Pfarrer über die Verwendung des Geldes entscheiden. In der Einheitsgemeinde von Unter- und Oberentersbach wurden 1821 Niklaus Isenmann, Johann Jehle, Felix Rothmann und Anton Halter zu Mitgliedern des Stiftungsvorstandes gewählt.
Nach ihrer Wahl wurden die Gewählten vom Bezirksamt Gengenbach verpflichtet. Die Forderung nach Einbeziehung von nichtamtlichen Kirchenmitgliedern, auch „Laien“ genannt, war für die evangelisch geprägte großherzogliche Regierung kennzeichnend.
Das Protokoll der Sitzungen war vom Lehrer der Schule zu führen. Der Rechner der Stiftung wurde vom Vorstand gewählt. In der Sitzung hatte er kein Stimmrecht. Die Sitzungen fanden sonntags nach dem Nachmittags-Andacht im Pfarrhaus statt. Ein Sitzungsgeld war nicht vorgesehen. Lediglich der Rechner erhielt eine Aufwandsentschädigung. 1821 wurde Georg Isenmann diese Aufgabe übertragen.
Das vorhandene Kapital der Stiftung konnte zu einem Zinssatz an Bürger ausgeliehen werden. Da die eingehenden Zinsen den Kapitalstock stärkten, blieb der kirchenbauliche Zweck der Stiftung erhalten. Die Schatztruhe, in der Gelder und Unterlagen zur Kreditvergabe aufbewahrt wurden, musste mit zwei verschiedenen Schlössern gesichert werden, wodurch das Vier-Augen-Prinzip gewährleistet wurde.
In einer Zeit, in der es noch keine Sparkassen und Volksbanken gab, waren Kirchenstiftungen von den Bürgern geschätzte Einrichtungen.
1835 war der „Papierfabrikant Jakob Knäble zu Entersbach“ im Besitz eines Kredits aus der Kapellen-Stiftung in Höhe von 1.500 Gulden, was ein stattlicher Betrag war. Abgeschlossen hatte er den Kredit zu 5 % Zins. Wegen der rückläufigen Anfragen nach einem Kredit wurde der Zinssatz von 5 % auf 4,5 % gesenkt. Deshalb wollte die Nikolaus-Kapellen-Stiftung auch bei Knäble den anfänglich festgelegten Zinssatz ermäßigen. Dies wurde ihr vom Bezirksamt Gengenbach erlaubt. Dass das Amt sich bei dieser Genehmigung dabei auf einen „Hohen Erlass“ des Mittelrheinkreises in Offenburg berief, zeigt, welches Ausmaß die Bürokratisierung damals bereits angenommen hatte.Als die Nachfrage nach einem Kredit aus dem Kirchenfond noch mehr zurückging, wurde der Zinssatz auf 4 % gesenkt. Das hat im August 1835 den Taglöhner Philipp Effinger bewogen, von der Stiftung 500 Gulden aufzunehmen. Vielleicht wollte er sich damit ein kleines Haus, evtl. mit ein paar Ziegen, errichten. Stiftungsvorstand und Bezirksamt haben der Vergabe zugestimmt.
Kirchliche Schulverwaltung
Bei der Einführung der allgemeinen Schulpflicht wurden vielfach die Meßner als Lehrer eingesetzt. (In Zell diente beispielsweise das „Mesner-Haus“ neben der Kirche als erstes Schulgebäude.) In Unterentersbach war unter anderem Pflug-Wirt Joseph Isenmann Meßner. Am 16. Februar 1837 wurde er von Lehrer Riele in diesem Dienst abgelöst. Damit fielen die Aufgabe des Meßners und die des Lehrers zusammen.
Der Vorgesetzte des Meßners und des Lehrers war in den Anfängen der Volksschule der Pfarrer. Entsprechend starken Einfluss auf den Unterricht hatte die Konfession. Doch war auch hier die badische Regierung bemüht, den Einfluss des Pfarrers durch Einbeziehung von zwei Volksvertretern auszugleichen. Sie wurden von den Bürgern gewählt.
Ab 1838 sollten Pfarrer und Bürgermeister der Schulverwaltung gemeinsam vorstehen.
Erst 1862 entschloss sich die badische Regierung für die Schulaufsicht staatliche Schulräte einzusetzen.
Regierung und Kirche im Streit
Die badische Regierung und die katholische Kirche waren sich über die Abgrenzung ihrer Zuständigkeiten nicht immer einig. Die Kirche fühlte sich in Sachen „Kirchen-Stiftung“ vom Staat bevormundet. Im Mai 1854 sorgte die Verlesung einer bischöflichen Anordnung im Sonntagsgottesdienst für Furore. Darin ließ der Erzbischof von Freiburg seine Absicht verkünden, die Verwaltung der Kirchenstiftung an sich zu ziehen. Die örtlichen Stiftungsvorstände sollten die Anträge „ausschließlich“ bei der Kirchenbehörde einreichen, um sie von ihr genehmigen zu lassen.
Die badische Regierung, die das Kontroll-Recht bislang für sich allein beansprucht hatte, sah in dieser Verlautbarung aus heiterem Himmel einen Rechtsbruch und drohte strafrechtliche Maßnahmen an. Der Erzbischof rufe die Pfarrer zum Ungehorsam gegen die Regierung auf.
„Da der Erzbischof in keiner Weise befugt ist, derartige Erlasse zu erlassen, so sind dieselben nach höchster Ermächtigung Seiner königlichen Hoheit des Regenten [sprich Großherzog] und Großherzoglichen Staatministeriums“ für „nichtig und unverbindlich erklärt“.
Sollte ein Pfarrer oder ein anderes Stiftungs-Mitglied in irgendeiner Weise der Aufforderung des Erzbischofs nachkommen, habe der Bürgermeister eine Strafanzeige zu stellen. Den Straftätern drohe eine Geld- oder Gefängnisstrafe. Der verkündete Erlass erzeuge bei den Bürgern „Erregung von Hass und Verachtung gegen die Regierung“.
Der Eklat fällt in die Amtszeit des Erzbischofs Hermann von Vicari, der seit 1842 die Amtsgeschäfte führte. Er darf als Hardliner bezeichnet werden, ohne dass damit die Schuld für den Streit allein ihm zugesprochen wird. Nicht von ungefähr hat damals der aus Zell a. H. stammende Rechts-Professor Franz Joseph Buß die Bevormundung der Kirche durch den Staat kritisiert. Der vorausgegangenen Einsetzung des Domherrs von Vicaris zum Bischof hatte die badische Regierung noch zugestimmt, weil das hohe Alter des Amtsbewerbers keinen hartnäckigen Streit mit der Regierung hatte erwarten lassen.
Quelle
Stadt-Archiv Zell a. H. – Abteilung Unterentersbach XVI. 1. u. 4