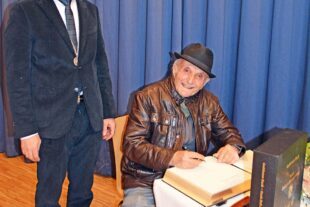Ein Tierdrama war es, das die gelernte Krankenschwester Gwendolyn Hättig das Filzhandwerk sowie den Umgang mit dem Spinnrad erlernen ließ. »Ich war mit meinem Pferd ausreiten und habe auf einer Schafweide ein Mutterschaf gesehen, das gerade ein Junges bekommen hatte – und beide«, die heute 48-Jährige atmet angesichts der Erinnerung schwer aus, »beide lagen leblos da.«
Sie half Mutter und Kind, nahm sie mit nach Hause auf den Bauernhof, bekam sie schließlich geschenkt. Wohin aber mit der beim Scheren anfallenden Wolle? »Wenn es die eigene Wolle ist, dann ist sie zu schade um nur Kissen zu füllen oder sie wegzuschmeißen, ich wollte was Sinnvolles damit machen.«
So also kam sie vor 19 Jahren zum Filzen. Zunächst fertigte sie aus der nicht gewebten, elastischen Textilie beispielsweise Krippenfiguren und Handtaschen. »Es ist ein unglaublich befriedigendes Gefühl, wenn man mit seinen Händen etwas herstellt«, strahlt die aus Haslach stammende Wahlbiberacherin.
Sehr bald kamen Schuhe hinzu. Zunächst fertigte sie für ihren damals dreijährigen Sohn ein Paar, indem sie eine Platte filzte, die einzelnen Teile herausschnitt und zusammennähte. »Sabine Sälinger aus Unterharmersbach hat mir und meiner Freundin dann aber gezeigt, wie man Schuhe an einem Stück filzen kann.«
Die Wolle von vorzugsweise deutschen oder auch österreichischen Bergschafen verwendet Gwendolyn Hättig heutzutage dazu. Sie ersteht sie (ausschließlich mit Wasser und Seife) gewaschen sowie kardiert – sprich sorgsam gekämmt und daher aus einzelnen Haaren bestehend -, naturbelassen sowie gefärbt. Der Arbeitsplatz: Das Waschbecken samt Ablage im Werkelraum.
Der Trick mit der Seife
Zunächst wird aus Teichfolie die Sohle geschnitten, »die kommt nachher aus dem Schuh wieder raus.« Um diese Vorlage legt Hättig nun die Wolle, in dünnen Lagen, über Kreuz, durchnässt sie jeweils mit warmer Seifenlauge und reibt sie mit den Fingern. Denn: Wärme und Feuchtigkeit lassen das Wollhaar aufquellen, seine Schuppen und Widerhaken klappen auf.
»Dadurch haben die Haare die Chance, sich neu zu verbinden«, erklärt die zierliche Frau, sie spricht leise, doch bestimmt, »durch das Reiben verhaken sich die gequollenen Haare ineinander.« Hilfreich ist dabei die geriffelte Struktur der Waschbeckenablage, auch ein altes Waschbrett hat sie schon als Unterlage verwendet.
Von Natur aus allerdings nimmt Schafswolle »ganz ungern Wasser an«. Ein Grund dafür, dass man früher wasserfeste Kleidung aus Filz herstellte – Hirtenmäntel und Hüte sind das beste Beispiel. Diesen Unwillen der Wolle gegen Wasser trickst man beim Filzen mit Seife aus. Sie sorgt dafür, dass die Wollhaare das Wasser gut aufnehmen und dadurch schneller und besser aufquellen, sich besser ineinander verzahnen, verfilzen.
Nach jeweils zwei aufgebrachten Lagen wird der Schuh gewendet, der seitliche Überstand eingeschlagen und durch Reiben ebenfalls verfilzt. Auf diese Weise wird die untere mit der oberen Lage verbunden. »Es ist mir einmal passiert, dass ich das nicht richtig gemacht hab´«, gesteht Gwendolyn Hättig, »da ging der eine Schuh dann auf der Seite auf, nur der andere Schuh war gut.« Weil es nur wenige Einfüßler gebe, habe sie daher nochmals frisch anfangen müssen, schmunzelt sie.
Ohne Wulste und haltbar
Besagter Überstand muss zwar ausreichend, jedoch keinesfalls zu groß bemessen sein, »sonst entsteht ein seitlicher Wulst, den man spürt und auch sieht.« Auf jeder Seite an die zehn Schichten aus zuvor abgewogener Wolle (im vorliegenden Fall 68 Gramm pro Seite, für Größe 38) legt Gwendolyn Hättig wie beschrieben aufeinander, teils mit andersfarbiger Wolle Muster legend. Stetig dichter wird der Filz dabei.
Ist er fest genug, schneidet sie den Schuh am Einschlupf auf und filzt ihn nun von innen an. Besonders kräftig reibt die Filzerin die Einschlupfkanten: »Hier müssen sich die Wollhaare wegen der hohen Beanspruchung gut schließen. Aber wenn was gut angefilzt ist, kriegt man das nicht mehr auf, da kann man so oft in den Schuh rein- und rausschlupfen wie man will.« Ihre eigenen Filzschuhe, die sie seit dreieinhalb Jahren zuhause trägt, gehen mit glänzendem Beispiel voran.
Mit dem Verfestigen der Einschlupfkanten glättet Gwendolyn Hättig diese gleichzeitig, sie reibt und reibt, mit aller Kraft. »Der Schuh ist jetzt schon fester«, konstatiert sie nach einer Weile, »aber nicht so, dass er schon haltbar wäre.« Schließlich erkennt man genau daran die Qualität eines Filzschuhes: dass er fest genug und dadurch lange haltbar ist.
Kraft und Gefühl
Von jetzt an ist in punkto Muskelkraft endgültig Verausgabung gefragt, mit vollem Körpereinsatz: Der Schuh wird in ein Geschirrtuch gerollt und mit den Händen gewalkt. »Filzschuhe zu machen ist echt ein Knochenjob«, lacht die körperliche Arbeit Gewohnte leise, »früher war das Männerarbeit.« Denn nur durch ausgiebiges, kraftvolles Walken wird der Schuh richtig fest, schrumpft durch das weitere Verfilzen rundherum um einige Zentimeter. »Kinder- und Frauenschuhe gehen noch«, erklärt Hättig, zeitweise außer Atem, »aber ab Schuhgröße 41 wird es richtig schwierig«, dennoch ist bei ihr erst ab Größe 48 Schluss.
Mit »Gewalt« alleine ist es allerdings nicht getan: »Man muss mal in die Längs- und mal in die Querrichtung walken und immer rechtzeitig wechseln, damit keine Wulste entstehen«, so Gwendolyn Hättig, »das muss man im Gefühl haben.« Schließlich wird der Schuh auf einen Leisten gezogen und diesem durch möglichst starkes, doch gefühlvolles Hin- und Herreiben angeformt.
»Bis nix mehr geht«
»Ich filze so lange, bis nix mehr kleiner geht«, erklärt die Handwerkelnde, zeitweise außer Atem. Ist der Schuh so weit fertig, wird er in Essigwasser gewaschen, um nach der ausgiebigen Behandlung mit Seifenlauge den PH-Wert wieder dem natürlichen Niveau anzugleichen, darauf folgt das Trocknen.
Nun schneidet Gwendolyn Hättig eine Ledersohle zu, locht sie und näht sie an. Und sofern es sich nicht um einen einfarbigen Schuh handelt, lebt sie beim anschließenden Verzieren mit beispielsweise Stickereien ihre Kreativität aus. Alles in allem eine Arbeit von vielen Stunden.
Als sie – damals, vor 19 Jahren – feststellte, wie warm, bequem, temperaturausgleichend und atmungsaktiv die Schuhe sind (»man kriegt auch im Sommer keine Schweißfüße darin«), wollte sie jedes Mitglied ihrer Großfamilie mit dieser Wohltat beglücken. »Aber wenn man noch wenig Erfahrung hat, bekommt man nicht die richtige Größe hin«, denn je nach Haltung und Fütterung der Schafe und je nachdem, wie kalt der Winter war, verändert sich die Wolle mit ihren Filzeigenschaften.
»Irgendwann hatte ich mindestens zehn paar Schuhe, die keinem in der Familie passten.« Also verkaufte Gwendolyn Hättig die Fußschmeichler mit ihrer ebenfalls filzenden Freundin auf dem Markt. Auf dem nächsten Biberacher Weihnachtsmarkt werden die Hobbyprodukte wieder zu sehen sein, hofft sie schon jetzt.
Handwerk
Wohl schon vor über 8000 Jahren entwickelten Hirten im asiatischen Raum die Technik des Filzens, um aus Schafs- oder Kamelwolle Dinge wie Kleidung, Decken und Zelte herzustellen. Heutzutage ist das Filzen noch immer Ausbildungsberuf, stellt eine Fachrichtung innerhalb des Textilhandwerks dar.