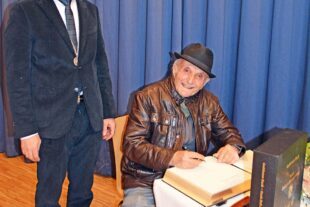Um 5500 vor Christus begann sich die Menschheit in Mitteleuropa vom Jäger und Sammler hin zu bodenständigen Bauern zu entwickeln. Für Besiedelung, Ackerbau und Viehhaltung wurden Freiflächen benötigt. Der Raum des heutigen Baden-Württemberg war zu mehr als 80 Prozent bewaldet. Der Mischwald bestand aus Buchen, Ahorn und Eichen zusammen mit Tannen, Kiefern und Fichten. In den mil-den Tieflagen war überwiegend die Eiche anzutreffen während sich in den Mittelgebirgen wie dem Schwarzwald und dem Schwäbischen Wald Nadelbäume, vorwiegend Tannen, wohlfühlten.
Mit dem Ausbau von Ackerbau und Viehzucht begann der Mensch den Wald zurückzudrängen. Bei den Rodungen konzentrierte man sich zunächst auf die fruchtbaren Böden in tieferen Lagen. Tacitus, der römische Schriftsteller (55 – 120 n. Chr.) fand Germanien noch als Land »mit unheimlichen Wäldern und abscheulichen Sümpfen« (Mooren) vor.
Energieintensiver Broterwerb
Die Wälder der Mittelgebirge blieben bis ins Mittelalter von Rodungen verschont. Ein wachsender Bedarf an Acker- und Weideland sowie die Ausbeutung von Silbervorkommen trieben Erschließung und Raubbau im Schwarzwald voran. Das Minengewerbe verschlang enorme Mengen an Grubenholz, Energieholz zur Erzverhüttung und nicht zuletzt Bauholz zur Besiedelung. Das obere Wiesental wie das obere Münstertal entwickelten sich zu Bergbauregionen. Mit einer »Waldordnung« wollte Abt Christoph zu St. Blasien 1464 die Waldverwüstung eindämmen. Dieses Regelwerk richtete sich vornehmlich gegen das Zurücklassen von Reisig und hohen Baumstümpfen nach dem Holzeinschlag. Der Silberabbau endete im dreißigjährigen Krieg (1618 – 1648). Am Hochrhein entstanden Hüttenwerke, welche aus dem Schwarzwald mit Erz und Holz versorgt wurden. Ein Beispiel… Der jährliche Holzbedarf des Eisenwerks Eberfingen lag bei 10.000 Tonnen und wurde per Floß herangeschafft. Schwarzwaldholz wurde allmählich knapp und teuer, was in der Mitte des 18. Jahrhunderts zu einer Energiekrise und den Niedergang der lokalen Eisenherstellung führte. Städte wie Freiburg und Basel bezogen einen bedeutenden Teil ihres Brennholzbedarfs über die Flößerei. Dreisam und Wiese wurden bedarfsgerecht ausgebaut, was zu einer Übernutzung der anliegenden Wälder führte.
Zu den energieintensiven Waldgewerben gehörten die Glashütten. Die Herstellung von einem Kilogramm Glas verschlang einen Raummeter Holz. Für die Glasproduktion wurde Quarzsand und Pottasche benötigt. Drei Teile Pottasche kamen auf einen Teil Quarzsand. Den Quarzsand entnahm man den Bächen. Pottasche entstand beim Verbrennen von Buchenholz. Mehr als 80 Prozent des Holzbedarfs ging zur Pottaschegewinnung drauf. Für den Betrieb einer Glashütte wurde jährlich die Ausbeute von 20 bis 30 Hektar Wald verheizt. War der Wald abgeholzt, zogen die Waldglashütten in Absprache mit den Grundherren um. Erste Betriebe am Feldberg gehen auf das Jahr 1579 zurück. Das Holz vom Blasiwald wurde von 1579 bis 1716 durch die Glasproduktion aufgebraucht. Die Zeit der Waldglashütten endete in der Mitte des 18. Jahrhunderts.
Holzkohlegewinnung
Die Köhlerei benötigte für den Abtransport des Produkts keine Flussanbindung. Teilweise über Saumpfade und Wege gelangte die Ware in Eisenwerke und Städte. Wanderköhler folgten dem Holzeinschlag. Die Köhlerei hatte keine besonderen Ansprüche an die Form des Rohstoffs Holz. Auch Äste, Knüppel und Wurzelanläufe aus Buche kamen zur Verarbeitung. Buchenholzkohle hat den höchsten Kohlenstoffgehalt, die höchste Heizkraft und keine Schadstoffbelastung. Das Holz musste trocken abgelagert sein.
Durch Verkohlen erreichte man eine höhere Energiedichte im Vergleich zum Brennholz. Holzkohle wurde zur Verhüttung von Erzen verwendet. Sie kam überall dort zum Einsatz wo hohe Temperaturen notwendig waren, während Flammen- und Rauchbildung unerwünscht war. Dazu gehörte die Weiterverarbeitung gewonnener Metalle. Als Schmiedekohle war sie genauso begehrt wie bei der Beheizung von Bügeleisen und eisernen Ondulierstäben.
Holzkohle diente als Rohstoff bei der Holzteer- und Pechgewinnung. Mit Holzteer imprägnierte man Schiffe und Fachwerkkonstruktionen. Auch Wagenschmiere wurde daraus hergestellt. Die konservierende Wirkung nutzte man um die Leichen von Königen und Feldherrn einzureiben, damit sie der Nachwelt als Mumie erhalten bleiben. Aus Buchenholzteer wurde Hustensaft gewonnen. Holzkohle kam auch bei der Pechgewinnung zum Einsatz. Pech vermischte man mit Bienenwachs und erhielt Zugsalbe. Die außerhalb von Städten angesiedelten Pulvermühlen verwendeten Holzkohle bei der Herstellung von Treibladungspulver. Im Laufe des 19. Jahrhunderts verlor die Köhlerei an Bedeutung. 2005 gab es in Deutschland noch 12 Köhlereibetriebe.
Bestandsaufnahme
Gegen Ende des 18. Jahrhunderts bereiste Herzog Karl Eugen von Württem-berg seine Waldungen im Schwarzwald. Dabei vermisste er wertvolle Holländertannen. Stehendes Holz war weitgehend aufgebraucht. Weitgehende Kahlflächen bestimmten das Landschaftsbild im Murg- und Enztal. Regional gab es Versuche die Wälder zu verjüngen. Eine Holznot gab es nicht. Zeitzeugen beklagten die Plünderung der Schwarzwälder Tannenwälder durch Holzhandelskompanien. Hier und da gab es Ansätze wertvolle Starkhölzer für den Export heranzuziehen. Großflächige Kahlhiebe waren nicht die Regel. Ohne Plan wurden Einzelbäume geschlagen. Verjüngungsmaßnahmen in Form von Saat und Pflanzungen waren die Ausnahme. Verbissschäden durch Wild- und Weidevieh behinderten eine Naturverjüngung. Die Landwirtschaft wurde auf Kosten der Wälder ausgedehnt.
Reutefeld und Schälwald
Bis ins beginnende 20. Jahrhundert wurde in den Waldgemeinden Reutefeldwirtschaft betrieben. Was es damit auf sich hatte entnehmen wir den Aufzeichnungen von Ritterbauer und Stabhalter Andreas Kuderer (1854 – 1942) in Durbach-Gebirg. Ein Reutefeld entsteht, in dem man dem Wald durch Rodung Flächen für Ackerbau und Beweidung abringt. Diese Flächen wurden zunächst für 15 bis 20 Jahren als Wald, danach zwei bis drei Jahre als Acker bewirtschaftet. Die Erträge waren bescheiden.
Das 15- bis 20-jährige Niederholz wurde im Herbst geschlagen und kam zumeist im Weinberg zur Verwendung. Der Boden wurde etwas gehackt oder gepflügt, Reisig und Abfallholz hat man in Reihen auf dem Hang verteilt und verbrannt. Diesen Vorgang nannte man »Rüttibrennen«. Eiserne Haken an langen Stangen kamen zum Einsatz, um das Feuer über das Reutefeld von oben nach unten zu ziehen und eine unkontrollierte Ausbreitung zu vermeiden. Die anfallende Asche war die einzige Düngung. Im Folgejahr wurde Roggen, danach Kartoffeln und schließlich Hafer gepflanzt. Mit dem Roggenstroh wurden die Rebzweige am Stock befestigt. Ritterbauer Kuderer erinnert sich: Es wurde Reute gemacht.
Danach wurde das Feld für 18 bis 20 Jahren wieder seinem Schicksal als Viehweide überlassen. Man holzte ab, was da war. Um das Anpflanzen kümmerte sich vor den 1860er Jahren auf den Höfen niemand. Die Reutefelder waren mit Hasel und Birken bewachsen, welche das Weidevieh verschmähte. Hasel und Birken waren in Küferwerkstätten als Fassreifen begehrt. Abnehmer war u. a. die Reifschneiderei Burger in Zell a. H. Dort wurden Reifen für Pulverfässer geschnitten, welche wegen der Funkengefahr nicht aus Eisen sein durften.
Das Vieh wurde zum Weidegang in die Wälder getrieben. Schweine wurden mit Bucheckern und Eicheln gemästet. Sämlinge konnten sich so nicht entwickeln, eine Naturverjüngung fand nicht statt. Um die Erträge in Land-, Forstwirtschaft und dem Weinbau zu steigern wurden Baumschulen und Musterpflanzgüter für Futterkräuter und Weinbau eingerichtet. Zur Entlastung der Forstwirtschaft ging man zur Stallviehhaltung über. Der wertvolle Dung wurde in Landwirtschaft und Weinberg ausgebracht.
Salpeter zur Herstellung von Treibladungspulver wurde von den Wänden der Güllegruben abgekratzt. Mit schriftlichen Anleitungen und der preiswerten Abgabe von Jungpflanzen erleichterte der badische landwirtschaftliche Verein den Ausstieg aus der Reutefeldwirtschaft hin zum Eichenschälwald, welcher von der Regierung des Großherzogtums Baden gefördert wurde. Eichenschälwälder dienten vorwiegend der Erzeugung von Rinden, deren Inhaltsstoffe in den Gerbereien gebraucht wurden. Aus der gemahlenen Rinde wurde Lohe gewonnen, die als Gerbsäure bei der Lederherstellung Verwendung fand.
Ritterbauer Andreas Kuderer galt als Vorreiter bei der Umgestaltung seines 57 Hektar großen Betriebs. Um das Vieh von der Waldweide abzuhalten, zäunte er seine Weideflächen ein, pflanzte Obstbäume, legte Schälwaldungen an und verlegte sich auf Hochwald mit unterschiedlichen Baumsorten. Zwischen den Reihen der Laubholzkulturen pflanzte er Christbäume, welche ihm den Ruhm des badischen Christbaumpioniers einbrachten.
Die Umtriebszeit für Eichenschälwälder lag bei 15 bis 25 Jahren. Pro Hektar erntete man 120 Zentner Rinde und 50 Ster Schälprügel. Die Freude an den Eichenschälwäldern dauerte nicht lange. Einfuhren von Quebrachoholz aus Argentinien und Paraguay sowie zollfreie Eichenrinden aus Frankreich und Österreich-Ungarn ließen den Preis für heimische Gerbrinde einbrechen. 30 Jahre kämpfte Stabhalter Andreas Kuderer vergeblich für angemessene Schutzzölle auf Importrinde. Die Regierung jedoch befürchtete Wettbewerbsnachteile für die deutsche Lederindustrie und ging nicht auf das Begehren der Schälwaldbesitzer ein. Diese wurden um 1900 von Zukunftsängsten geplagt. Die Anlage von Hochwald mit einer Umtriebszeit von 60 bis 80 Jahren wurde als zu langwierig angesehen.
Aufforstung mit System
Um eine Aufforstung in großem Stil auf den Weg zu bringen, begann man in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts mit der Klärung der Eigentumsverhältnisse. Dazu war es notwendig die Wälder zu vermessen und zu kartieren. Im Ergebnis waren Privat- und Kommunalwälder im Umfeld der Dörfer in Tief- und Mittellagen, Staatswälder dagegen in den Hochlagen zu finden. Im Anschluss galt es Wälder von Nutzungsrechten zu befreien, denn Bürger vieler waldbesitzender Kommunen waren mit komfortablen Ansprüchen an kostenlosem Bezug von Brenn-, Bau- und Rebholz ausgestattet. Angesichts des zunehmenden Bedarfs an Nutzholz wurden ertragreiche Baumarten per Saat und Pflanzung angebaut. Eine Waldpflege in Form von Durchforstungen hat sich nur zögerlich durchgesetzt. Mit der verkehrstechnischen Erschließung des Schwarzwaldes wurde Holz als Brennstoff zunehmend durch Kohle ersetzt. Laubhölzer verloren an Wertschätzung.
Die industrielle Nutzung verlangte nach Nadelholz. In Süddeutschland kamen zunehmend Fichten zum Anbau. Zur Jahrhundertwende vom 19. ins 20. Jahrhundert waren die Wälder weitgehend reproduziert. Große Teile der Landbevölkerung wanderte in die Städte ab, wodurch der Nutzungsdruck auf die Wälder gemindert wurde. Die ersten Jahrzehnte des 20. Jahrhunderts waren für den Wald besonders ergiebig. Statt auf Kahlhiebe setzte man auf natürliche Verjüngung.
Bei den Vorbereitungen zum zweiten Weltkrieg ging es auch um die Bereitstellung von Holz. Der nachhaltigen Waldwirtschaft folgten »Verjüngungshiebe«, welche zu einer Übernutzung von 150 Prozent führten. Reparationshiebe nach Kriegsende hinterließen große Kahlflächen und schürten Ängste vor einer Holznot. In vielen Gegenden machte sich die Bevölkerung an die Wiederaufforstung von Kahlflächen. Dabei gab man Fichten den Vorzug, da diese mit dem rauen Kahlflächenklima besser zu Recht kommen.
Nationalpark belebt Tourismus
Gegen Ende der 1960er Jahre führten niedrige Holzpreise bei gleichzeitig hohen Lohnkosten zu existenziellen Problemen in der Forstwirtschaft. Der Brennholzanteil bei der Holzernte lag zu Beginn des 19. Jahrhunderts noch bei 80 Prozent und fiel bis 1970 auf 2 Prozent. Aktuell werden 40 Prozent der Holzproduktion energetisch genutzt. Diskussionen um das Waldsterben in den 1980er Jahren führten zu einer Sensibilisierung weiter Kreise der Bevölkerung für das Ökosystem Wald.
Angestoßen durch diese Entwicklung kam es nach den Sturmereignissen der Jahre 1990, 1999 und 2007 zu einer breiten Auseinandersetzung mit waldrelevanten Themen in den unterschiedlichsten gesellschaftlichen Gruppierungen. Ein naturnaher Umbau der öffentlichen Wälder in den letzten Jahrzehnten hat dazu geführt, dass der Fichtenanteil reduziert wurde. Profitiert davon haben Tanne und Buche. Mischwälder haben zugenommen. Je naturferner sich das Leben der Stadtmenschen im Alltag abspielt, desto konkreter ist der Wunsch des Einzelnen sich irgendwo ein heiles Stück Natur zu retten. Im Wald sieht man ein natürliches, gut funktionierendes Ökosystem, welches nach der Überzeugung weiter Kreise aus jeglicher Nutzung herausgenommen werden sollte. Diese ökologische Grundhaltung gepaart mit touristischen Interessen führte zur Einrichtung des Nationalparks Schwarzwald. Für den Fremdenverkehr ist diese Rechnung aufgegangen. Experten zufolge wird eine Rückentwicklung zum Urwald Jahrhunderte in Anspruch nehmen und kaum naturgerecht ablaufen, denn über den Tourismus wird weiterhin der Mensch schädliche Spuren hinterlassen. Kritiker des Nationalparks mahnen, das Beste was dem Wald passieren kann ist eine nachhaltige Bewirtschaftung.
Ratlosigkeit
Besitzer von Wirtschaftswald werden aktuell von anderen Sorgen geplagt. Lange Zeit galt der Wald als Sparkasse des Besitzers. Diese Bedeutung ist augenblicklich in Frage gestellt. In den vergangenen drei Jahren ließen
Trockenheit, Käferbefall und Sturmereignisse die Forstwirtschaft vielerorts vom Ertrags- zum Zuschussgeschäft verkommen. Das Schadholzaufkommen durch Käfer und Trockenheit reduzierte sich im Ortenaukreis von 250.000 Festmeter anno 2019 um rund zwei Drittel auf 85.000 Festmeter im Wirtschaftsjahr 2020. Es wäre vermessen hier eine Trendwende herauszulesen. Die Bestandsaufnahme 2020 wird getrübt durch Sturmholzaufkommen von 100.000 Festmeter.
Problematisch sind zudem die europaweit großen Schadholzmengen, welche auf den regionalen Markt durchschlagen. Ein geplantes Wirtschaften ist unter diesen Umständen nicht möglich. Die dominierende Frage ist wie es mit unseren Wäldern weitergehen wird, welche Baumarten auf welchen Standorten überlebensfähig sind. Dabei geht es um Entscheidungen für einen Zeitraum von achtzig Jahren und mehr. Der Wald sollte dabei nicht nur als Wirtschaftsfaktor sondern in seiner Gesamtheit als Klimaanlage, Sauerstofflieferant, Wasserspeicher, Lebens- und Erholungsraum betrachtet werden.
 Foto: Oestreich
Foto: Oestreich Foto: Oestreich
Foto: Oestreich Foto: Oestreich
Foto: Oestreich