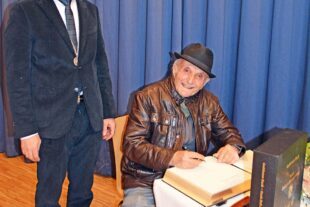»Gucken Sie mal: das meiste, was Gelb ist, ist das Jakobskreuzkraut.« Bernd Welle zeigt auf den Rand der Landstraße in der Peripherie Nordrachs, zeigt auf die Böschung am Bachlauf, auf die Wiesen: »Es wächst überall, man muss etwas tun.«
 Foto: Inka Kleinke-Bialy
Foto: Inka Kleinke-Bialy Foto: Inka Kleinke-Bialy
Foto: Inka Kleinke-Bialy
Tatsächlich sieht das derzeit in leuchtendem Gelb blühende Kraut hübsch aus. So hübsch, dass es durchaus auch als Tischschmuck in Vasen zu finden ist. Welle aber stellt das die Haare zu Berge. Denn die unter anderem an ihren dreizehn Blütenblättern zu erkennende botanische Schönheit ist in allen Pflanzenteilen hoch giftig, am stärksten konzentriert sich das Gift in den Doldenblüten.
Weil der 56-Jährige sich nicht sicher ist, ob das Gift auch über die menschliche Haut aufgenommen werden kann, zieht er sich vorsichtshalber Handschuhe an. Dann erst reißt er zur Demonstration eine der bis zu einem Meter hoch werdenden Pflanzen aus dem Boden.
Regina Ostermann hingegen, promovierte Forstwirtschaftlerin und Geschäftsführerin des Landschaftserhaltungsverbandes Ortenaukreis, erklärt auf Anfrage dazu: »Das Jakobsgreiskraut, auch Jakobskreuzkraut genannt, ist nicht beim Berühren giftig! Darauf hinzuweisen ist uns immer sehr wichtig.«
Die Pflanze gehört zu den pyrrolizidinalkaloid (PA)-haltigen der insgesamt 20 heimischen Greiskrautarten. PA reichert sich in der Leber an, wird vom Körper nicht wieder abgebaut und zeigt erst im Laufe der Zeit seine schädigende Wirkung.
Während Nutztiere wie Ziegen und Schafe mit dem Gift recht gut klar kommen, ist es für Rinder und die diesbezüglich noch empfindlicheren Pferde besonders gefährlich: Eine Aufnahme von 40 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht gilt bei Pferden als tödlich. Doch auch geringere Mengen werden als schädlich eingestuft, beispielsweise können sie bei trächtigen Tieren zu Fehlgeburten führen.
Eigentlich verschmähen die Tiere die in der Regel zweijährige Pflanze aufgrund ihrer Bitterstoffe. Diese allerdings sind in der im ersten Jahr ausgebildeten Blattrosette weniger stark konzentriert und werden daher vor allem von jungem Vieh durchaus abgeweidet. Noch kritischer jedoch wird es, wenn das Jakobskreuzkraut als Beimischung in Heu oder Silage im Futter landet. In diesem Zustand nämlich verliert es sämtliche die Mäuler abstoßenden Bitterstoffe.
Eintrag in die menschliche Nahrungskette
Bernd Welle persönlich bereitet das Gift keine Schäden, denn als Vorsitzender des örtlichen Kleintierzuchtvereins hält er ausschließlich Kaninchen. Doch als Küchenchef einer Nordracher Rehaklinik fürchtet er, dass PA durch die Verarbeitung von Tierleber in die menschliche Nahrungskette gelangt, »in Leberwurst und Leberknödel«.
In der Milch von Kühen, die PA-haltige Pflanzen fressen, ist das Gift von Wissenschaftlern offenbar nachgewiesen worden. Überdies kann Jakobskreuzkraut gegebenenfalls über die Salaternte, Kräutertees und pflanzliche Arzneimittel in Magen und Leber des Menschen landen.
In welcher Menge das Gift für Homo Sapiens tödlich wirkt, ist nicht bekannt. Das Bundesamt für Risikoforschung stuft jedoch eine tägliche Aufnahmemenge von nur zehn Mikrogramm (also zehn tausendstel Milligramm) pro Kilogramm Körpergewicht als bereits schädlich ein.
Seit zwei bis drei Jahren beobachtet Bernd Welle die in den Medien bundesweit beklagte Ausbreitung des Jakobskreuzkrautes auch in Nordrach. In England, Irland und der Schweiz ist die in Europa heimische Pflanze inzwischen sogar meldepflichtig. Naturschützer allerdings warnen vor einer unbedachten Bekämpfung: Immerhin 200 Insekten dient das Jakobs-Kreuzkraut als Futterpflanze, unter anderem den nur an ihr lebenden Raupen eines schwarz-rot gezeichneten Falters, dem Jakobskrautbär.
Ausbreitungsursache?
Warum sich die Pflanze hierzulande in den letzten Jahren derart ausgesamt und damit zu einer »Problempflanze« entwickelt hat – darüber rätseln die Experten noch. Einige sehen den Grund darin, dass sie öfter zur Blüte kommt, weil Grasböschungen heutzutage seltener gemäht werden. Gerade dort ist das anspruchslose Kraut häufig zu finden, waren seine Samen früher doch in Saatgutmischungen für Straßenbegleitgrün zu finden.
Von den Böschungen aus wird die Giftpflanze dann in die Wiesen und Weiden eingetragen. Hier wiederum könnte eine weitere Ursache liegen: Aufgrund rückläufiger Milch- und gestiegener Düngerpreise wird Weideland zunehmend weniger intensiv bewirtschaftet. Weil die Grasnarbe nun weniger Nährstoffe erhält, wird sie lückiger. Der positive Effekt: Wildkräuter können sich hier verstärkt ansiedeln – aber eben auch das giftige Kreuzkraut.
Diesem Herr zu werden gestaltet sich als denkbar schwierig. Mähen ist keine Option. Denn sobald der Blütenstängel niedergemacht wird, mutiert die Pflanze zum mehrjährigen Gewächs. Weil sie immer wieder versucht, aus ihrer Blattrosette auszutreiben und zu blühen.
Vielseitiger Überlebenskünstler
Auch die – wie der Löwenzahn mit Flugschirmen bestückten – Samen des Korbblütlers haben es in sich. Sowohl was ihre Zahl, ihre Verbreitungs- als auch ihre Keimfähigkeit betrifft. »Jeder Samen, der auf den Boden fällt, geht auf«, betont Welle. Mehr noch: Auch gemähte Blütenstängel bilden unzählige Samen aus, per Notreife.
»Man kommt dem Kraut eigentlich nur mit Unkrautvernichter bei – was für die Umwelt schwierig ist«, will Bernd Welle keinesfalls für ihrerseits hochgiftige Herbizide werben, »am besten hackt man die Pflanze mit der Hand raus.« Wobei die Wurzel komplett entfernt werden muss, denn im Boden verbliebene Stücke treiben erneut aus.
»Wenn jeder wenigstens auf seinem eigenen Grund und Boden das Kraut in den Griff kriegt, dann wäre schon sehr, sehr viel getan«, hofft der Nordacher auf eine Sensibilisierung möglichst vieler Einheimischer.