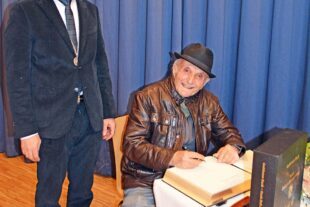In seiner Sitzung vom Montag beschloss der Gemeinderat einstimmig, die Regiejagd weiterzuführen. Der Beschluss erfolgte vorzeitig. Im Vorfeld gab es viele Gespräche zwischen der Gemeinde als größten Eigentümer in dem zur Debatte stehenden Revier und den Jägern über mögliche Veränderungen in der Struktur der Jagd. Letztere hatten das Modell der Regiejagd grundsätzlich in Frage gestellt.
 Foto: Susanne Vollrath
Foto: Susanne Vollrath Foto: Detlef Dürrenfeld
Foto: Detlef Dürrenfeld Foto: DJV/Rolfes
Foto: DJV/RolfesVor vollen Reihen im Lesesaal der Hansjakob-Halle fasste Bürgermeister Carsten Erhardt am Ende diesen Tagesordnungspunkt zusammen: »Es war eine gute und eine wichtige Diskussion.« Zuvor hatte er die »roten Linien« vorgestellt, die – das stellte er nochmals deutlich heraus — unabhängig vom konkreten Jagdsystem bei der Jagdvergabe nicht überschritten werden dürften.
Wald vor Wild – Wild vor Wald?
Die Quintessenz: Die Jagd ist für die Gemeinde ein Mittel zum Zweck der Waldbewirtschaftung. So wies der Bürgermeister auf die Bedeutung der Naturverjüngung für den Gemeindewald hin. Dies bedeute, dass der Wildverbiss unter Kontrolle gehalten werden müsse, um den Wald ohne Nachpflanzung nachhaltig zu stärken. Forstliche Gutachten hätten diese Politik bestätigt, so Erhardt. Eine weitere »rote Linie« betrifft die Zertifizierung. Der Nordracher Wald ist nach PEFC zertifiziert, was für die Holzvermarktung wichtig sei und nicht aufs Spiel gesetzt werden könne. Diese erlaube nur in Ausnahmefällen chemischen Verbissschutz. Auch sei der Gemeindewald ein großes Reservoir an wertvollen Ausgleichsflächen für Ökopunkte, die Schutzflächen für das Auerwild dürften von einer möglichen Umgestaltung der Jagd nicht betroffen sein. Deshalb sei für die Gemeinde Nordrach »eine unmittelbare Einflussnahme auf das Abschussverhältnis und die Gesamtabschusszahl unverhandelbar«, was unter anderem den direkten Durchgriff auf die Pirschbezirke, die Verteilung der Sitze und die Vergabe von Begehungsscheinen nach sich ziehe. Diesen Kernthemen hatte die Jagdgenossenschaft Nordrach zuvor einstimmig zugestimmt. Sie unterstütze das Vorgehen der Gemeinde, so Erhardt. Dieses Gremium sprach sich für die Weiterführung der Regiejagd aus. Der Gemeinderat sah das genauso. »Wir können den Wald nur gut bewirtschaften, wenn die Jäger mit im Boot sind«, ordnete Erhardt die Beziehung der beiden Parteien ein.
Gespräche über »rote Linien«
Die war in letzter Zeit nicht unbedingt ungetrübt, geprägt von vielen Gesprächen und münden wohl letztendlich im Ausstieg zahlreicher Jäger. Die verstehen nicht, warum eben diese »roten Linien« nicht auch in einem Pachtvertrag festgehalten werden könnten. »Die Regiejagd ist das Mittel der Wahl«, hält der Bürgermeister am erprobten Grundprinzip fest und kündigte Veränderungen in der konkreten Ausgestaltung innerhalb der »roten Linien« an. Er wünscht sich, dass die Nordracher Jäger weiterhin die Gemeindeflächen bejagen. Auf Nachfrage erläuterte Erhardt, welche Änderungen besprochen wurden. So sollen das Vergütungssystem überarbeitet, die Pirschbezirke neu geordnet und zusätzliche Äsungsflächen (Wildäcker) auf Gemeindekosten angelegt werden. Auch in den Belangen der jagdlichen Einrichtungen will die Gemeinde zukünftig ihrer Verantwortung nachkommen und die Wildbretvermarktung besser und transparenter gestalten. Die Kritikpunkte seien ernst genommen worden, »damit Nordracher in Zukunft auch auf der Nordracher Jagd sind.«
Die Sache mit den Abschussquoten
Die wachsende Unzufriedenheit unter den Jägern, die in den vergangenen Monaten zu vielen Gesprächen mit der Gemeinde geführt hatte, hat jedoch nicht nur mit dem rechtlichen Rahmen zu tun, sondern auch waidmännische Ursachen. Eine besteht in einer überdurchschnittlich hohen Abschussquote für Rehwild, die von der Kommune festgelegt ist und für deren Erfüllung neun Jäger und ein Jungjäger zuständig sind. Der Wildbestand wird vom Förster anhand des aufgefundenen Wildverbisses geschätzt. Und auch auf einen gewissen »Jagdsog« wird gemeindeseits verwiesen, weil durch den stringenten Abschuss in der Nordracher Regiejagd Wild aus angrenzenden Revieren zuwandert.
Wunsch nach mehr Einfluss
Die jagdlichen Einrichtungen wurden in der Vergangenheit fast vollständig von den Jägern, nicht von der Gemeinde finanziert und betrieben und auch die Arbeiten, die für die Beseitigung von Wildschäden nötig waren, etwa wenn Wildschweine eine Wiese umgewühlt hatten, wurde ohne Aufwandsentschädigung von den Jägern geleistet – alles in deren Augen fast so, wie es bei einem Pachtverhältnis wäre. Ein großer Teil der örtlichen Jägerschaft wünschen sich mehr Einfluss auf die Ausgestaltung der Jagd und das Recht zu mehr Eigenständigkeit. Die Jäger plädieren für eine sinnvolle Ansitzjagd mit der gezielten Entnahme einzelner Individuen. Das sei jedoch mit der ständig steigenden Abschussquote nicht mehr möglich. Um die Quote zu erfüllen, mussten sie ihrer Ansicht nach immer mehr Zugeständnisse an die Waidgerechtigkeit machen. Sie forderten Veränderungen und haben zahlreiche Ansatzpunkte: Der Wildverbiss könne auch verringert werden, indem das Äsungsangebot für das Wild verbessert wird – eine Maßnahme, die nun in den neuen Katalog aufgenommen wurde. Auch in Bezug auf die Forderung, die notwendigen jagdlichen Einrichtungen nicht nur zu organisieren, sondern zur Verfügung zu stellen, reagierte die Gemeinde. Wo nötig plant sie zukünftig Aufwandsentschädigungen für geleistete Arbeiten zu zahlen und das Material bereitzustellen und überlegt, ob eventuell sogar Vergütungen für die Erfüllung der Abschussquote geleistet werden. Die Wildbretvermarktung soll ebenfalls in einem veränderten Modus ablaufen. Die Jäger können zukünftig Jahr für Jahr entscheiden, ob sie das erlegte Wild selbst vermarkten wollen oder es der Gemeinde überlassen. Doch sind diese Maßnahmen genug?
Am liebsten pachten
Am allerliebsten würden die Jäger es sehen, dass die Regiejagd beendet und Pirschbezirke aufgelöst oder zumindest in Teilen in eine Jagdpacht umgeändert würden. Günstig würde sich ihrer Meinung nach auch auswirken, wenn durch angepasste Quoten der Jagddruck auf das Wild geringer würde und »die Tiere auch mal Ruhe haben könnten«. Der Jagderfolg kommt – trotz der im Abschussplan hoch geschätzten Wildpopulation – nämlich immer schleppender, was darin begründet sein könnte, dass sich die Tiere wegen des hohen Jagddrucks vermehrt in ihre Einstände zurückziehen.
Wald und Wild – Naturschutz und Jagd
»Wir haben uns angestrengt, die Kritikpunkte soweit zu entspannen, dass es weitergehen kann«, sagte Bürgermeister Erhardt gestern bei einem Hintergrundgespräch. Trotz der zahlreichen Gespräche fühlt sich jedoch ein großer Teil der Jäger nicht in ihren Argumenten ernst genommen. Die wirtschaftlichen Interessen der Kommune und der Waldeigentümer würden stets über den Belangen der Jagd und des Naturschutzes stehen. Vielen Nordracher Jägern ist es wichtig, den ökologischen Kreislauf zu begleiten und eine beiderseits tragfähige Balance zu erreichen, gesundes Wild eingeschlossen. Bisher hat nach Auskunft der Gemeinde zwar noch kein Jäger seinen Begehungsschein abgegeben, etliche haben jedoch kürzlich die von ihnen selbst errichteten jagdlichen Einrichtungen abgebaut. Zu Beginn der Hauptjagdzeit steht die Gemeinde Nordrach nun vor einer neuen Herausforderung.
Hintergrund-Infos
Das Jagdrecht ist ein Eigentumsrecht, das dem Eigentümer einer »bejagbaren« Fläche zusteht. Derjenige, der das Jagdrecht besitzt, ist berechtigt, den Jagdbezirk zu bewirtschaften. Mit dem Jagdrecht, das in §1 Abs. 1 BJagdG geregelt ist, ist die Pflicht zur Hege des Wilds verbunden. Nicht jeder Waldbesitz hat eine hinreichende Größe für eine sinnvolle Bejagung. Deshalb hat der Gesetzgeber verfügt (§§ 8 ff BJagdG), dass kleinere Einheiten zu gemeinschaftlichen Jagdbezirken zusammengefasst werden. Das führt dazu, dass die Eigentümer der Grundstücke nur gemeinsam als »Jagdgenossenschaft« zur Ausübung des Jagdrechts berechtigt sind. Die Jagdgenossenschaft verfügt stets per Mehrheitsentscheid, ob sie das Jagdrecht selbst ausüben möchte (»Regiejagd«) oder vollumfänglich an einen Dritten weitergeben möchte (»Jagd verpachten«). Dabei werden die Stimmen nicht 1:1, sondern nach einem Gewichtungsschlüssel gewertet. Verkürzt ausgedrückt: Wer die größten Flächen hat, hat am meisten zu sagen. Die Flächen, um die es in Nordrach geht, umfassen insgesamt ungefähr 900 Hektar, davon etwa 600 Hektar Gemeindewald und 300 Hektar Privatwald mit mehreren Eigentümern. Die Privatwaldflächen arrondieren in diesem konkreten Fall den Gemeindewald. Dadurch sind zweckmäßigere Außengrenzen entstanden. Die Gemeinde Nordrach ist alleiniger Bestimmer über die Jagdform in diesem Revier.
Jagd im Pachtmodell
Der Eigentümer (falls das Revier groß genug ist) beziehungsweise die Jagdgenossenschaft kann das Jagdrecht selbst ausüben oder an Dritte weitergeben. Wird ein Dritter Jagdpächter, hat dieser die Verpflichtung so zu jagen, dass der Wald keinen Schaden nimmt. Allein der Pächter muss für entstehende Wildschäden aufkommen. Auch Bau, Instandhaltung und Aufbau jagdlicher Einrichtungen fallen beim Pachtmodell in den alleinigen Verantwortungsbereich des Pächters. Der Pächter entrichtet außerdem einen vereinbarten Pachtzins. Fast alles lässt sich im Pachtvertrag regeln. Dem Waldeigentümer entstehen keine Kosten durch die Jagd. Er darf jedoch nicht direkt auf die Ausgestaltung der Jagdausübung durchgreifen.
Jagd als »Regiejagd«
Alternativ kann eine sogenannte »Regiejagd« aufgesetzt werden. Sie ist in Nordrach seit Anfang der 1980er Jahre das Jagdmodell in dem Revier, über das aktuell diskutiert wird. Dabei unterliegt die Jagdleitung dem kommunalen Forstamt. Es beauftragt jagdausübungsberechtige Personen (»Jäger«) mit der Jagd, bestimmt die konkreten Pirschbezirke auf der Gesamtfläche und legt Abschussquoten fest. Die Jäger beantragen einen kostenpflichtigen Begehungsschein und bekommen einen Pirschbezirk zugewiesen. Sie sind stets an die Weisungen der Jagdleitung gebunden und haben Anspruch auf die Erstattung ihrer Aufwendungen. Der Jagdleiter, meistens ist das der Förster der Kommune, kann bei der Regiejagd direkten Einfluss auf den praktischen Jagdbetrieb nehmen: indem er zum Beispiel andere Jäger in Pirschbezirke setzt, wenn dort die gemeindeseits vorgegebenen Abschussquoten nicht eingehalten werden. Die Einnahmen aus dem Wildbretverkauf stehen der Gemeinde zu. Pachteinnahmen entstehen keine. Wildschäden muss die Gemeinde, nicht der Jäger regulieren. Die Regiejagd in Nordrach wird vor dem Hintergrund eines unbefristeten Vertrags zwischen Jagdgenossenschaft und Gemeinde betrieben.
Waidgerechte Jagd
Beide Varianten stehen im neuen baden-württembergischen Gesetz zum Wildtiermanagement (JWMG) gleichberechtigt nebeneinander. Im Falle der Regiejagd ist von einem maximalen Schutz für die Wälder auszugehen, da die Waldeigentümer maßgeblich mitbestimmen. Der Vorteil für die Jäger: Sie müssen sich weniger um das Revier kümmern, keine jagdlichen Einrichtungen pflegen oder Schäden regulieren. Dafür ist in der Regiejagd die Jagdleitung zuständig. Gleichzeitig sind sie nicht wirklich frei in ihrer Jagdausübung.
Egal bei welchem Modell: Mit dem Jagdrecht ist die Pflicht zur Hege verbunden. Damit soll ein artenreicher und gesunder Wildbestand (§1 Absatz 2 BJagdG) erhalten werden ohne die Waldnutzung zu beeinträchtigen.
In § 1 Absatz 3 BJagdG ist zudem bestimmt, dass die Jagd »waidgerecht«, also nach guter fachlicher Praxis zu erfolgen hat. Dabei besitzt der Tierschutzaspekt eine hohe Relevanz. Im Tierschutzgesetz ist niedergelegt, dass es eines vernünftigen Grundes bedarf, um ein Wirbeltier zu töten: etwa um Nahrungsmittel zu gewinnen oder einem kranken Tier unnötiges Leid zu ersparen. Im JWMG ist in §38 davon die Rede, dass Tieren Schmerzen oder Leiden zu ersparen sind, die »über das unvermeidbare Leid hinausgehen«. Ein möglicher Wildverbiss ist selbst für viele passionierte Jäger demnach kein vernünftiger Grund ein Tier zu töten. Die Waidgerechtigkeit und der Respekt vor der Kreatur waren mit den geforderten Abschüssen – für einige Nordracher Jäger – nicht mehr vereinbar.