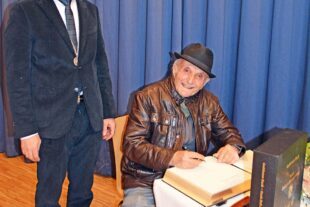In Zeiten, in denen die bürgerlichen Freiheiten in bedenklicher Art und Weise immer mehr eingeschränkt werden, kommt in zivilrechtlichen Verkehrsunfallsachen dem Grundsatz der Dispositionsfreiheit des Unfallgeschädigten nach wie vor hohe Bedeutung zu. Es ist allein die Sache des Geschädigten, ob und gegebenenfalls in welchem Umfang bzw. wie er einen ihm entstandenen Schaden behebt.
Falls kein Totalschadensfall vorliegt, in dem lediglich der Wiederbeschaffungsaufwand (Wiederbeschaffungswert abzüglich Restwert) ersetzt wird, kann der Geschädigte sich frei entscheiden und auswählen, ob er beispielsweise auf die Ausführung einer Reparatur verzichtet, nur eine Teilreparatur durchführen lässt oder eine gegenüber der Schadensschätzung kostengünstigere Reparatur durchführen lässt.
In jedem Fall hat der Geschädigte Anspruch auf Zahlung eines Betrages, der für die Durchführung einer fachgerechten Reparatur anfällt. Ein Unfallgeschädigter kann grundsätzlich frei wählen, ob er den Fahrzeugschaden im Reparaturschadensfall auf Grundlage konkret angefallener Reparaturkosten oder fiktiv nach in einem Kfz-Sachverständigengutachten oder Kostenvoranschlag ausgewiesenen Kosten berechnet.
Er kann auch zunächst auf Gutachtenbasis abrechnen und später noch zu einer Abrechnung auf Reparaturkostenbasis übergehen. Der Bundesgerichtshof hat nun vor Kurzem mit Urteil vom 5. April 2022 (VI ZR 7/21) eine bisher noch nicht entschiedene Schadenskonstellation geklärt. Dem Urteil lag folgender Sachverhalt zugrunde: Ein Unfallgeschädigter rechnete seinen unfallbedingten Fahrzeugschaden gegenüber der gegnerischen Kfz-Haftpflichtversicherung zunächst fiktiv auf Basis eines eingeholten Sachverständigengutachtens ab. Die Versicherung erstattete daraufhin die im Gutachten ausgewiesenen Reparaturkosten in Höhe von 5.521,64 Euro netto. Im Anschluss hieran ließ der Unfallgeschädigte eine Teilreparatur des trotz Unfallschäden noch verkehrssicheren Fahrzeugs durchführen, durch die Reparaturkosten in Höhe von 4.454,63 Euro netto zuzüglich der gesetzlichen Umsatzsteuer in Höhe von 846,38 Euro anfielen. Die im Rahmen der Teilreparatur angefallene Umsatzsteuer wollte der Geschädigte von der Versicherung dann ebenfalls noch erstattet bekommen. Dies hat die Versicherung allerdings abgelehnt.
Die dagegen erhobene Klage hatte in drei Instanzen (Amtsgericht, Landgericht, BGH) keinen Erfolg. Da der Geschädigte den Weg der fiktiven Schadensabrechnung gewählt hat und nicht zu einer konkreten Berechnung des Schadens auf Grundlage der durchgeführten Reparatur übergegangen ist, kann nicht der Ersatz, der im Rahmen der Teilreparatur angefallenen Umsatzsteuer verlangt werden.
Der Geschädigte hätte zwar von einer fiktiven Abrechnung auf eine konkrete Abrechnung übergehen können. Dies wäre hier jedoch für den Geschädigten unvorteilhaft gewesen. Daher wollte der Geschädigte die ihm vorteilhaften Elemente der Abrechnungsarten kombinieren. Eine Kombination fiktiver und konkreter Abrechnung ist insoweit jedoch nicht zulässig.
Der Geschädigte muss sich also entscheiden, ob er eine durchgeführte (Teil-)Reparatur insgesamt konkret abrechnet oder weiterhin fiktiv auf Gutachtenbasis abrechnen will. Eine Vermischung der unterschiedlichen Abrechnungsarten kommt nach der Rechtsprechung nicht in Betracht.
Michael Hug,
Rechtsanwalt, Zell a. H.